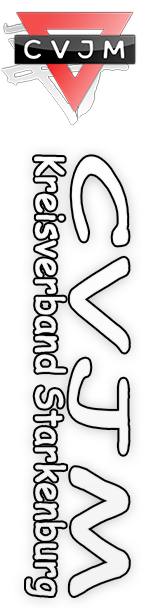Die Gnosis
1. Einführung - Vorbemerkungen
Die Gnosis hat eine Vorstufe im Griechentum: der Orphik. Diese hat ihren Namen von der mythologischen Gestalt des Sängers Orpheus. Von Orpheus wird berichtet, dass er durch seinen Gesang und sein Leierspiel auch Macht und Gewalt über Felsen, Bäume und wilde Tiere hatte. Als seine junge Frau Eurydike ihm durch einen Schlangenbiss entrissen wurde, folgte er ihr in die Unterwelt und rührte Hades und Persephone durch sein Spiel und die Klagelieder. Sie erlaubten ihm, seine Frau aus dem Hades mitzunehmen. Er durfte sich auf dem Weg in die Oberwelt jedoch nicht zu seiner Frau umdrehen. Da er sich jedoch zu früh nach Eurydike umwandte, entschwand sie nach hinten in die Tiefe der Unterwelt.
Das Entscheidende an der Orphik ist, dass sie eine Weltentstehungslehre mit einer solchen von der Entstehung und dem Wesen des Menschen verbunden hat.
Ihre Gedanken kreisen um den Gott Dionysos, der in dreifacher Gestalt erscheint: er ist einmal von den Titanen zerrissen und verschlungen worden, aber des Zeus Blitz hat die Titanen getroffen und verbrannt. Aus ihrer Asche ist dann das menschliche Geschlecht entstanden. So hat es (das menschliche Geschlecht) etwas titanisches, das heißt Widergöttliches und etwas Dionysisches (Göttliches) in seinem Wesen. Zeus hat das Herz des Dionysos vor den TItanen gerettet und daraus entstand dann die letzte Gestalt des Gottes, die des "Lösers", der den Frommen im Jenseits reiche Freude bringt.
Der Mensch ist somit seinem Ursprung nach mit Widergöttlichem behaftet. Der Körper, der von den Titanen stammt, ist das "Grab seiner Seele", eine Art Gefängnis, in dem sie gefangen liegt, bis ihre Schuld getilgt ist. Wir haben es also mit einer Seelenwanderungslehre zu tun. Wenn die Erlösung der Seele des Menschen nicht im ersten Leben vollzogen werden kann, dann eben in einem neuen, solange, bis sie befreit ist. Zu seiner Erlösung, das heißt zu seinem seligen Leben in der Unterwelt, muss sich der Mensch streng asketischen Lebensregeln unterwerfen. Die so genannte Orphik erlebte um die Zeitenwende einen neuen Aufschwung, und es verbindet sie mit der Gnosis die Verbindung von Welt- und Menschenentstehung, dem Dualismus von Leib und Seele und dem Zusammenhang des Göttlichen im Menschen und dem des "Lösers". Die Gnosis ist eine vielschichtige und schwer zu erfassende Erscheinung zur Zeit des Entstehens der jungen Christenheit.
Auf einen knappen und kurzen gemeinsamen Nenner gebracht, könnte man sagen, dass die Anhänger der Gnosis behaupten: Christus gilt etwas im Leben des Menschen - aber…
Und dann werden weitere Bedingungen genannt, um ewiges Leben erhalten zu können.
Der Kirchenvater Irenäus sagt zur Gnosis: "Nicht zwei oder drei kannst du auftreiben, die über denselben Gegenstand dasselbe sagen; im Namen und Sachverhalt widersprechen sie sich völlig." Irenäus sieht etwa 20 Gnostikerschulen, die ein eigenes Profil herausgearbeitet haben.
Walter Schmithals kommt zu folgender Umschreibung: "Wir verstehen unter Gnosis jene religiöse Bewegung, die den Menschen lehrt, sich als ein Stück göttlicher Substanz zu verstehen, das zwar durch ein verhängnisvolles Schicksal in die Gefangenschaft der ihm wesensfremden Welt und ihrer dämonischen Beherrscher geriet, der Befreiung daraus aber gewiss sein darf, da es die Erkenntnis seines unverlierbaren göttlichen Seins besitzt." (Walter Schmithals in "Neues Testament und Gnosis")
- Die Hauptmotive, in denen sich die Gnosis darstellt, sind:
- ein kosmischer Dualismus, sei es uranfänglicher, sei es abgeleiteter Art;
- der Darstellung vom Fall der Lichtsubstanz in die Gewalt böser Mächte;
- die Erkenntnis dieses menschlichen Seins und Schicksals;
- die Erlösung aus diesem Schicksal.
Den Gnostiker beschäftigt vor allem:
- das Verhältnis von Gott und Welt,
- das Verhältnis von Geist und Materie,
- den Fall des Menschen und seine Erlösung,
- der Weltanfang,
- die Weltentwicklung und
- das Weltende.
2. Begriffe "Gnosis" und "Dualismus"
2.1. Der Begriff "Gnosis"
Standortbestimmung
Die Gnosis ist wohl mit Recht eine "unpersönliche Massenbewegung" genannt worden. Sie hat sich etwa gleichzeitig mit dem Christentum entwickelt und erlebte ihre Blütezeit im 2. und 3. Jahrhundert.
Der Kirchenvater Epiphanius erfaßte in seinem Ketzerkatalog mehr als 60 gnostische Richtungen.
Erkenntnis bedeutet in der Gnosis das Wissen um Gottes Wesen und des Menschen Rettung - sprich: den (wieder) Aufstieg des Menschen zum Geist beziehungsweise seinen (wieder) Aufstieg aus der Finsternis zum Licht.
Erkenntnis in der Gnosis heißt also niemals verstandesmäßiges, historisches Wissen, das durch systematisches Erfassen einer Sache begreifbar gemacht wird. Damit hat die Gnosis nichts (oder nur sehr wenig) zu tun.
Das Wort Gnosis bedeutet "Erkenntnis".
Der zur Gnosis (zur Erkenntnis) gelangte Mensch gewinnt sein Wissen nicht durch Beobachtung, Erforschung (etwa der Naturgesetze) oder Selbstbesinnung, sondern durch Offenbarung. Auch dort, wo die Gnosis philosophiert, Denkgebäude aufstellt, wie etwa in der Emanationslehre Valentins, gibt sie nur Aufklärung, geoffenbarte Aufklärung, über das Wesen des Geistes und der Menschen. Das Wesen der Erkenntnis in der Gnosis ist religiöser, praktischer und soteriologischer Natur. Erkenntnis bedeutet das Wissen um Gottes Wesen und des Menschen Rettung, sprich: sein Aufstieg von der Materie zum Geist, von der Finsternis zum Licht.
Die Gnosis war/ist eine Erlösungslehre, die sich zusammen mit dem Christentum und in der Auseinandersetzung mit ihm entwickelte. Die Wurzeln der Gnosis liegen aber nicht nur im Alten Testament, wie es beim Christentum der Fall ist, sondern sie wurzelt auch im heidnischen Griechen- und Persertum.
Zur Zeit Jesu waren viele religiöse Vorstellungen der damals bekannten Welt zusammengeflossen, und auf dieser Religionsvermischung (dem Synkretismus) baut die Gnosis ihre Lehre auf.
Allerdings stellt die Gnosis keine einheitliche Bewegung dar. Sie ist wohl in drei Hautprichtungen gespalten, die sich so umschreiben lassen:
- iudaisierende Gnosis:
Hier herrscht das Judentum vor. Je nach Bedarf werden jedoch Elemente aus den anderen beiden Richtungen mit übernommen. - christianisierende Gnosis:
Hier herrscht das christliche Gedankengut vor. Jesus von Nazareth wird vor allem als der Mensch gesehen, der den Gnostikern in der Erkenntnis vorangegangen ist. - paganisierende Gnosis:
Hier herrschen vor allem magische Rituale vor. Durch Beschwörungen sollen die Geister den Menschen verfügbar gemacht werden (Paganismus). Jüdische und christliche Elemente sind auch hier vorhanden.
Eigentlich ist alle Gnosis nie etwas anderen als pagane Gnosis, auch wenn jüdische und christliche Elemente vorhanden sind.
Als einen allgemeinen Grundzug aller drei Hauptrichtungen kann man jedoch den Dualismus herausheben; auf der
- einen Seite sehen die Gnostiker Gott und seine Welt, das Licht und was Lichtcharakter trägt und auf der
- anderen Seite sehen sie alles das, was den Sinnen in irgendeiner Weise zugänglich ist, genannt die Welt der Finsternis und ihrer Mächte.
2.2 Der Begriff "Dualismus"
Der Gegensatz zum Dualismus ist der "Monos" = einzig, allein. Nur eine Substanz, nur ein Prinzip wird angenommen.
Der Dualismus ist das entscheidende Merkmal der Gnosis.
Im Dualismus (Denken in zwei Räumen) wird die Grundsätzlichkeit zweier Prinzipien vorausgesetzt. Es gibt nur zwei ursprüngliche Prinzipien im Weltgeschehen:
Gott - Welt / Leib - Seele / Geist - Stoff, um nur einige Beispiele zu nennen.
Edwin Suckut
- Irenäus ist Schüler des heiligen Polykarp, und der ist ein Schüler des Apostels Johannes. Irenäus kämpft gegen die Ketzer (Gnostiker), besonders in seiner Schrift "Entlarvung und Widerlegung der falschen Gnosis".
- Epiphanius lebte etwa um 375 nach Christus.